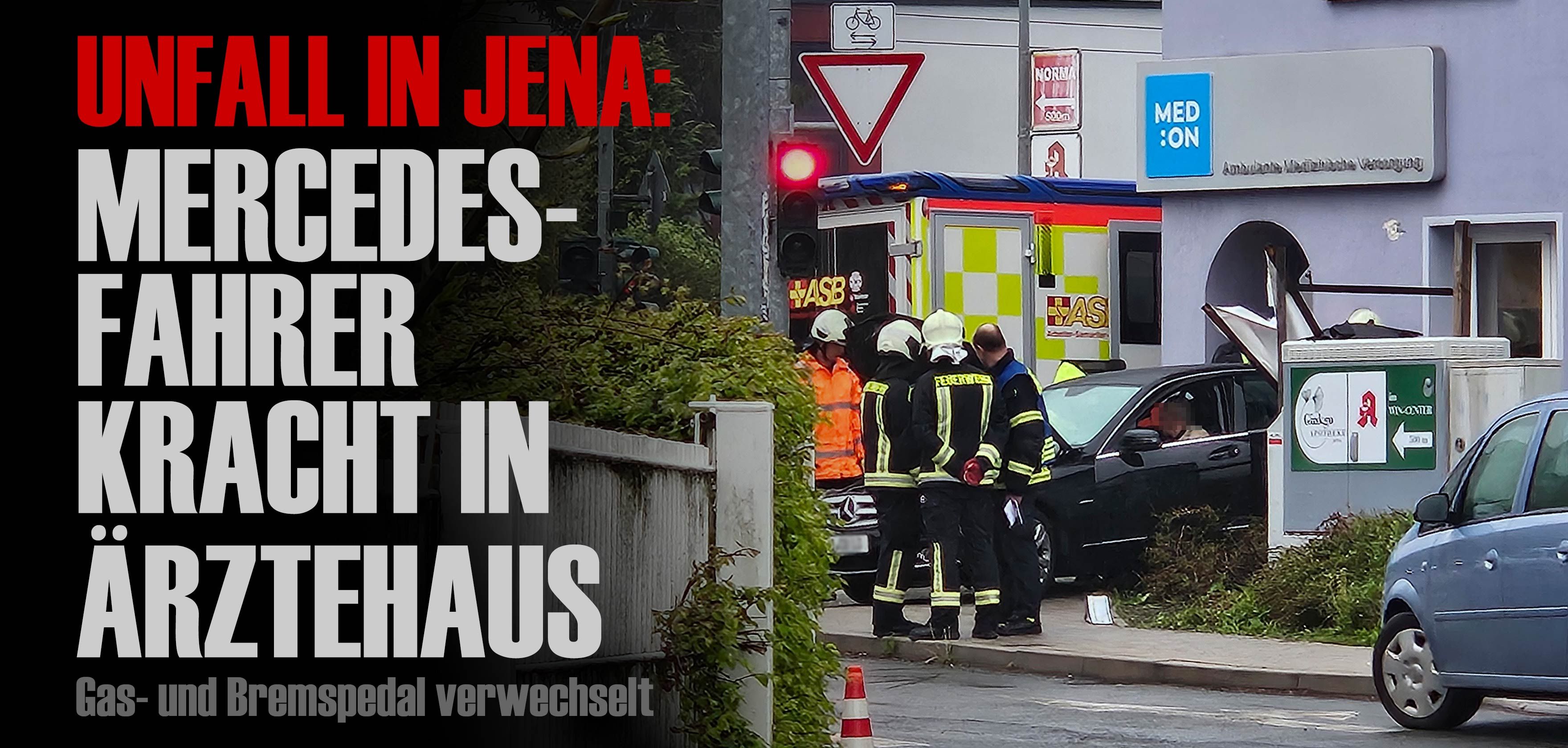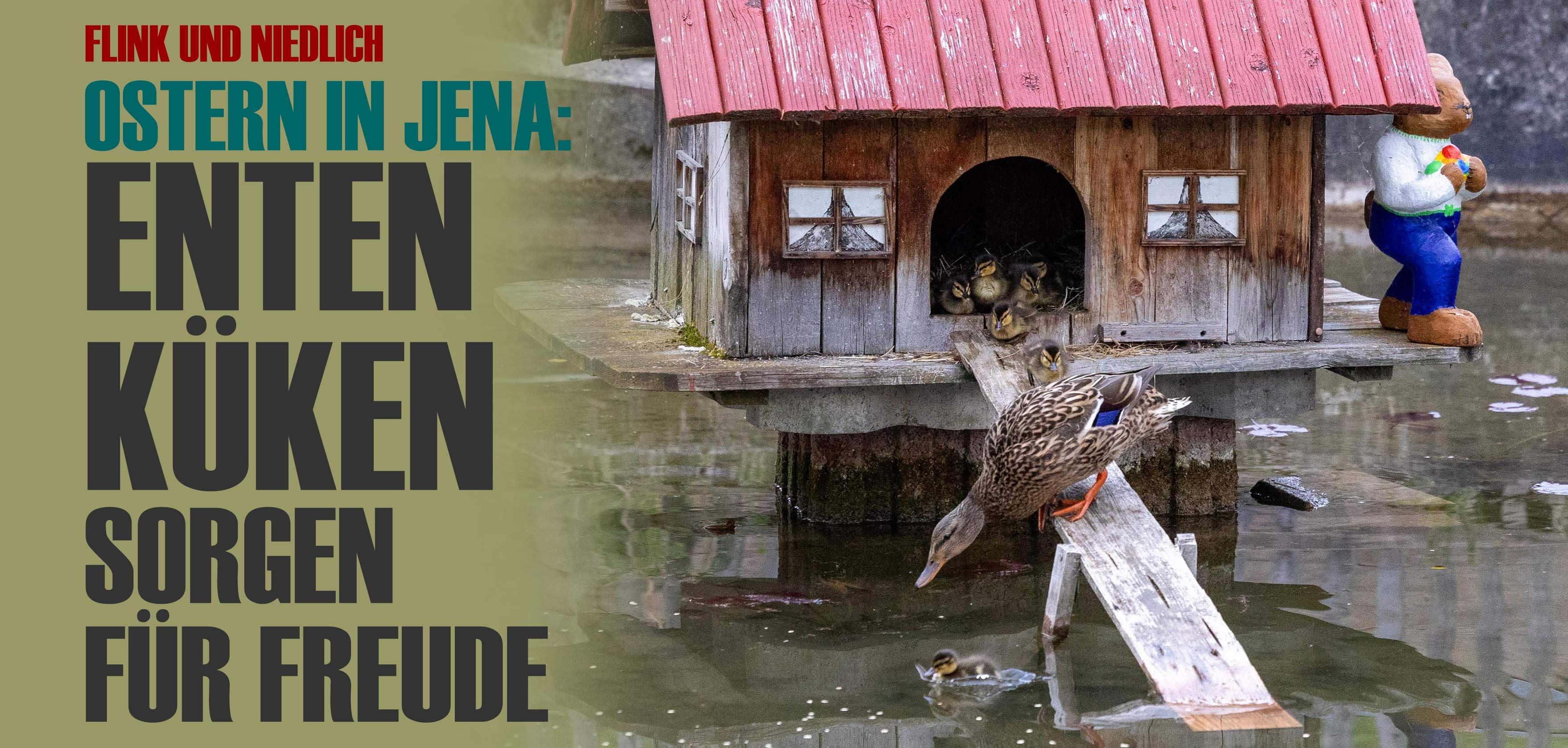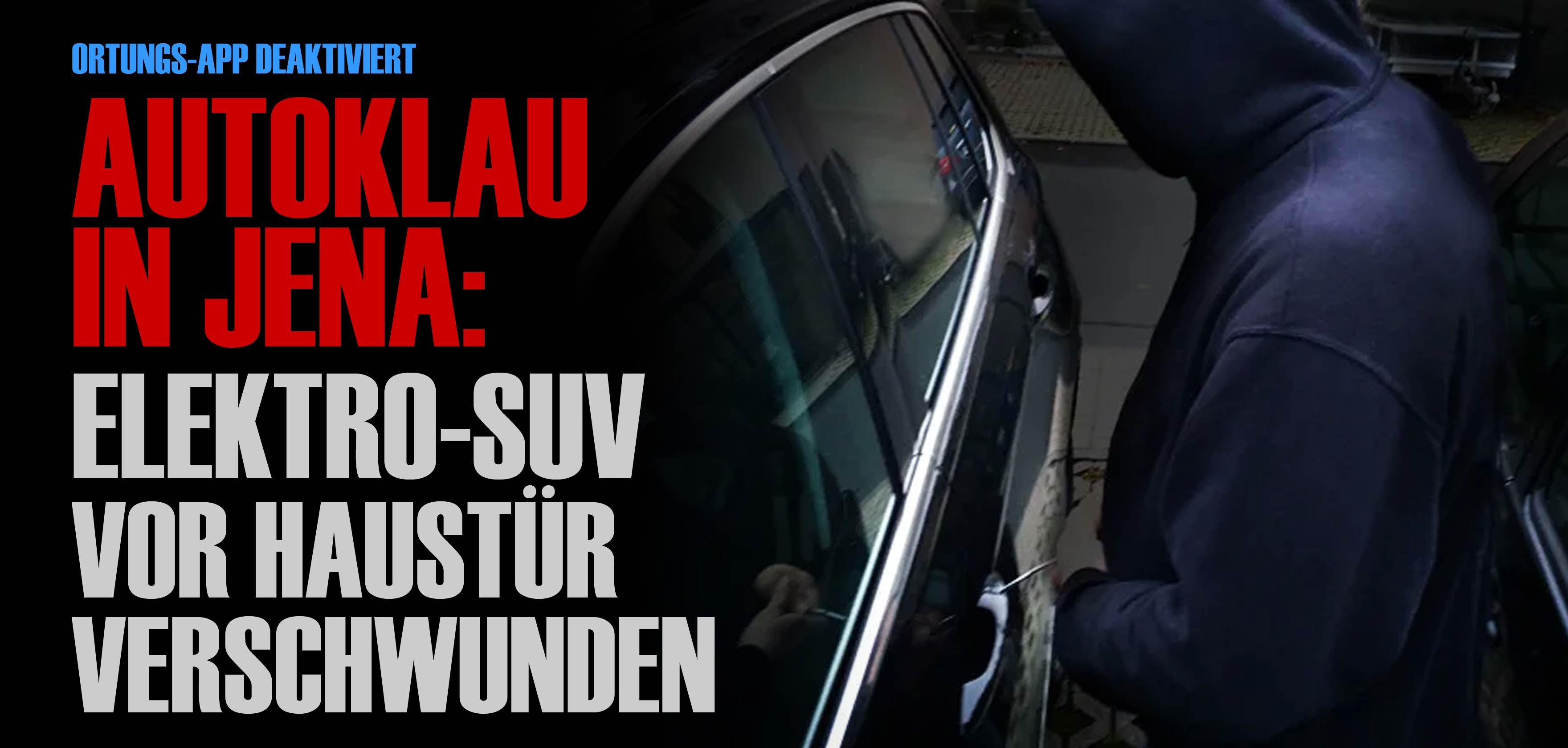JN-Ratgeber
Wohngesundheit: So lassen sich Schadstoffe verringern

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de
Teilen auf
Teppiche, Gardinen, Möbel oder Vinylböden: Wohngesundheit, so lassen sich Schadstoffe verringern.
Jena. Es gibt zahlreiche Wohnaccessoires, die mit Schadstoffen belastet sein können – sei es durch Lackfarben, Klebstoffe oder durch spezielle Imprägnierungen.
Ein erster Hinweis darauf kann ein unangenehmer, chemischer Geruch sein, der beispielsweise von einem neu erstandenen Polstersofa ausströmt.
Doch nicht jeder Giftstoff macht sich unbedingt geruchlich bemerkbar. Bestimmte körperliche Symptome wie beispielsweise Kopfschmerzen, Augenreizungen, Übelkeit oder allergische Hautreaktionen können ebenfalls ein Anhaltspunkt dafür sein, dass sich in der Wohnung eine ungesunde, chemische Substanz befindet.
Gütesiegel: Schadstoffgeprüft bedeutet nicht unbedingt schadstofffrei
Eine erste Orientierung bieten verschiedene Gütesiegel wie „Der blaue Engel“ oder auch das ÖkoControl-Zeichen. Zu beachten ist dabei allerdings, dass nicht alle existierenden Siegel auch immer eine komplette Schadstofffreiheit garantieren.
Manche Siegel gewährleisten erst einmal, dass ein Produkt schadstoffgeprüft ist und die tolerierten Grenzwerte unter den gesetzlichen Vorgaben liegen. Das beinhaltet zwar häufig, dass der Einsatz bestimmter Substanzen verboten ist.
Es können jedoch durchaus andere Schadstoffe darin vorkommen. Es empfiehlt sich daher, auf der Internetseite des jeweiligen Gütesiegel-Anbieters nachzusehen, welche Prüfkriterien zugrunde gelegt werden. Vor allem für Menschen mit Allergien sind verlässliche Angaben elementar.
Möbel: Unbehandeltes Holz immer besser
Giftstoffe in Möbeln kommen häufiger vor, wenn die Oberfläche lackiert ist. Eine weitere Schadstoffquelle sind auch formaldehydhaltige Klebstoffe, mit denen Holzteile vor allem bei Billig-Möbeln untereinander fixiert werden.
Demgegenüber haben unbehandelte Massivholzmöbel den geringsten Schadstoffgehalt. Idealerweise sollte auf die gesamte Öko-Bilanz des Mobiliars geachtet werden. So sollte der Rohstoff aus nachhaltiger Wirtschaft gewonnen sein und nicht Urwald-Rodungen entstammen.
Natürliche Fensterausstattung: Von Leinen-Vorhängen bis Holzjalousien
Auch Fensterdekorationen sind vor möglichen Schadstoffbelastungen nicht gefeit. Nicht selten sind die Textilien mit Flammschutzmitteln behandelt, die den allgemeinen Brandschutz im Wohnbereich zwar erhöhen, aber in die Raumluft gelangen und zum Beispiel zu Atemwegsreizungen führen können.
Eine Alternative dazu sind Vorhänge aus Bio-Leinen oder -baumwolle. Neben textilen Fensterausstattungen gibt es im Handel zum Beispiel auch naturbelassene Holzjalousien. Hierbei sollten bevorzugt Holzjalousien ohne Oberflächenlackierung gewählt werden. Weitere textilfreie Optionen sind Bambusjalousien.
Wer auf keinen Fall auf besonders preiswerte, bunt gefärbte Vorhänge verzichten möchte, sollte zumindest waschmaschinengeeignete Modelle wählen.
Mögliche Ausdünstungen lassen sich so bereits vor der erstmaligen Anbringung in der Waschmaschine und bei weiteren Waschgängen deutlich minimieren.
Bodenbeläge: Oft Teppich- und Parkettkleber problematisch
Bodenbeläge wie Teppiche bergen ebenfalls so einiges an Giftpotential und können unangenehme Gerüche durch Imprägnierungen absondern. Das lässt sich vermeiden, wenn öko-zertifizierte Naturteppiche im Wohnbereich ausgelegt werden.
Eine weitere Schadstoffquelle sind oftmals Teppichkleber, die für die rutschfeste Fixierung am Boden verwendet werden. Eine schadstofffreie Variante wären hier doppelseitige Teppichklebebänder oder Klettbänder.
Schadstoffe enthalten auch manche Parkettkleber für Holzböden. Eine Alternativlösung sind emissionsarme Klebstoffe.
Daneben werden aber auch klebstofffreie Böden angeboten, wie zum Beispiel Klickparkett oder Korkböden mit Klicksystem, die „schwimmend“ beziehungsweise lose auf dem Untergrund verlegt werden.
Bei der Auswahl eines konkreten Holzbodenbelags sollten ebenfalls die wichtigsten wohngesundheitlichen Gütekriterien geprüft werden. Im Zweifelsfall ist es am besten, beim jeweiligen Hersteller Informationen zu erfolgten Schadstoffprüfungen und -zertifikaten zu erfragen, die möglichst von einem unabhängigen Institut durchgeführt und ausgestellt wurden.
Text: Torsten Lux